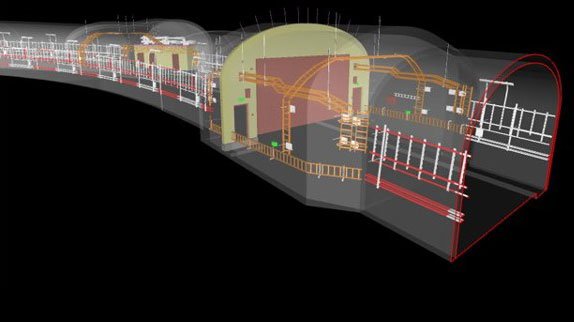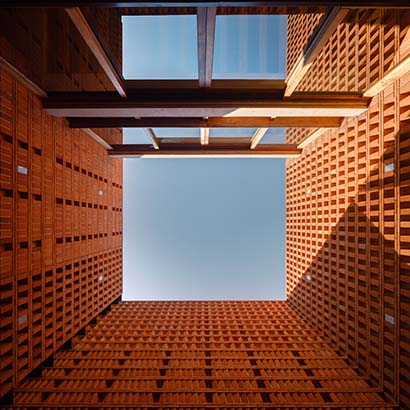Geschäftsjahr 2022 entwickelt sich besser als erwartet
Der Schweizer Baukonzern Implenia erwartet für 2022 einen Gewinn von mehr als 120 Millionen Franken. Bereits im ersten Halbjahr wurde die Marke von 80 Millionen Franken erreicht.
Der Baukonzern Implenia übertrifft die geplante Stärkung der Eigenkapitalbasis für das Gesamtjahr um 80 Millionen Franken. Der Konzern erwirtschaftet voraussichtlich bereits im ersten Halbjahr 2022 eine operative Leistung auf Stufe EBIT von mindestens 80 Millionen Franken (1. Halbjahr 2021: 40 Mio. Fr.). Bislang erwartete Implenia für das Gesamtjahr 2022 einen EBIT von mehr als 120 Millionen Franken und eine operative Leistung auf Stufe EBIT von mehr als 100 Millionen Franken.
Steigende Profitabilität
Implenia ist laut Medienmitteilung „mit einem attraktiven Portfolio in allen relevanten Märkten stark positioniert“. Dies äussert sich eigenen Angaben zufolge nicht nur im anhaltend erfreulichen Auftragseingang, sondern zunehmend auch in der Profitabilität. Es wird erwartet, dass alle Divisionen dieses Jahr einen verbesserten Ergebnisbeitrag leisten.
Wie der Konzern bereits am 1. März 2022 mitgeteilt hatte, rechnet dieser für das Gesamtjahr 2022 mit einem wesentlichen Gewinnbeitrag der Division Real Estate. Die anvisierte kräftige Ausweitung der Eigenkapitalbasis im Jahr 2022 wird im Rahmen der IFRS-Richtlinien zusätzlich durch die Neubewertung von einigen selbstgenutzten Betriebsliegenschaften verstärkt werden.
Über die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2022 sowie die höheren Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 will Implenia detailliert am 17. August 2022 berichten.
Weitere Informationen
implenia.com