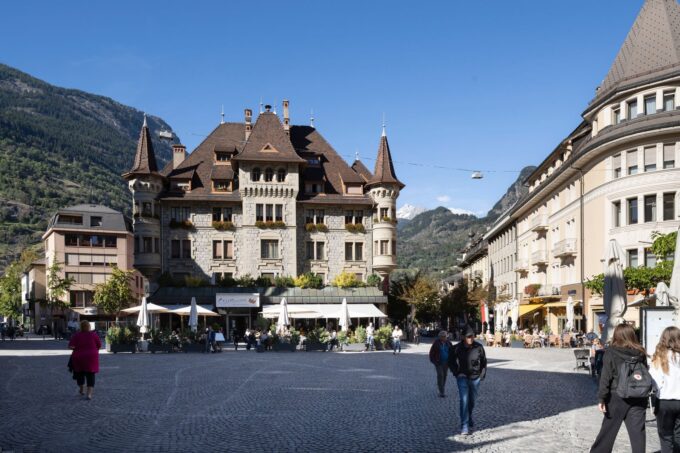Mit KI zu grünem Zement
Die Zementindustrie verursacht rund acht Prozent der globalen CO₂-Emissionen – das ist mehr als der gesamte weltweite Flugverkehr. Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben ein KI-gestütztes Modell entwickelt, mit dem sich neue Rezepturen für Zement schneller entdecken lassen – bei gleicher Materialqualität und einer besseren CO₂-Bilanz.

Mit infernalischen 1400 Grad Celsius werden die Drehöfen in den Zementwerken eingeheizt, um aus gemahlenem Kalkstein Klinker zu brennen, der Grundstoff für baufertigen Zement. Wenig überraschend: Solche Temperaturen lassen sich üblicherweise nicht einfach aus der Steckdose beziehen. Sie entstehen durch energieintensive Verbrennungsprozesse – und setzen dabei grosse Mengen Kohlendioxid (CO2) frei. Überraschend hingegen: Die Verbrennung ist für nicht einmal die Hälfte der gesamten CO₂-Emissionen verantwortlich. Der Grossteil davon ist in den Rohstoffen enthalten, die für die Herstellung von Klinker und Zement benötigt werden: CO2 ist chemisch im Kalkstein gebunden und wird bei der Umwandlung in den heissen Öfen freigesetzt.
Hier an der Rezeptur zu feilen und durch das Beimischen von alternativen zementartigen Materialien den Anteil an Klinker zu verringern, ist eine vielversprechende Strategie. Genau das hat ein interdisziplinäres Forschungsteam am Zentrum für Nukleare Technologien und Wissenschaften am PSI im Labor für Endlagersicherheit nun untersucht. Statt auf aufwendige Experimente und langwierige Simulationen setzten die Forschenden auf eine eigens dafür entwickelte KI-gestützte Modellierungsmethode. «Damit können wir Zementrezepturen simulieren und so optimieren, dass sie bei gleich hoher mechanischer Qualität deutlich weniger CO₂ ausstossen», erklärt Erstautorin der Studie und Mathematikerin Romana Boiger. «Anstatt Tausende Varianten im Labor zu testen, generiert unser Modell innerhalb von Sekunden konkrete Rezeptvorschläge – wie ein digitales Kochbuch für klimafreundlichen Zement.»
Mit ihrem neuartigen Ansatz konnten die Forschenden gezielt jene Zementrezepturen herausfiltern, die die gewünschten Kriterien erfüllen. «Die Bandbreite möglicher Materialzusammensetzungen – die letztlich die Eigenschaften des Zements bestimmen – ist enorm», sagt Nikolaos Prasianakis, Leiter der Gruppe Transportmechanismen am PSI, Initiator und Mitautor der Studie. «Unsere Methode ermöglicht es, den Entwicklungszyklus deutlich zu beschleunigen, indem vielversprechende Kandidaten ausgewählt und gezielt in experimentellen Untersuchungen weiterverfolgt werden.» Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift Materials and Structures erschienen.
Die richtige Rezeptur
Bereits heute werden Sekundärrohstoffe wie Schlacke aus der Roheisengewinnung oder Flugasche aus der Kohleverbrennung in die Zementrezeptur beigemischt, um Klinker zu sparen und damit die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Der globale Bedarf an Zeme
nt ist jedoch so gigantisch, dass diese Nebenprodukte nur einen Bruchteil davon abdecken können. «Was wir brauchen, ist die richtige Kombination an Materialien, die in grossen Mengen verfügbar sind und aus denen sich hochwertiger und zuverlässiger Zement produzieren lässt», sagt John Provis, Leiter der Forschungsgruppe für Zementsysteme am PSI und Mitautor der Studie.
Solche Kombinationen zu finden, ist jedoch anspruchsvoll: «Zement ist im Grunde ein mineralisches Bindemittel – im Beton erzeugen wir mit Zement, Wasser und Kies künstlich Minerale, die das gesamte Material zusammenhalten», erklärt Provis. «Man könnte sagen: Wir betreiben Geologie im Zeitraffer.» Diese Geologie oder besser gesagt die dahinterliegenden physikalischen Prozesse sind enorm komplex und ihre Modellierung am Computer dementsprechend rechenintensiv und teuer. Deshalb setzt das Forschungsteam auf künstliche Intelligenz.
KI als Rechenbeschleuniger
Künstliche neuronale Netzwerke sind Computermodelle, die auf Basis bestehender Daten trainiert werden, um komplexe Berechnungen zu beschleunigen. Beim Training wird das Netzwerk mit einem bekannten Datensatz gefüttert und «lernt» daraus, indem es die Gewichtung seiner internen Verknüpfungen so anpasst, dass es ähnliche Zusammenhänge rasch und zuverlässig vorhersagen kann. Diese Gewichtung dient als eine Art Abkürzung – ein schneller Ersatz für die sonst rechenintensive physikalische Modellierung.
Auch die Forschenden am PSI setzten ein solches neuronales Netzwerk ein. Die für das Training benötigten Daten erstellten sie gleich selbst: «Mithilfe der am PSI entwickelten Open-Source-Software GEMS für thermodynamische Modellierung berechneten wir für verschiedene Zementrezepturen, welche Mineralien sich beim Aushärten bilden und welche geochemischen Prozesse dabei stattfinden», erklärt Nikolaos Prasianakis. Durch die Kombination dieser Ergebnisse mit experimentellen Daten und mechanischen Modellen konnten die Forschenden einen verlässlichen Indikator für die mechanischen Eigenschaften ableiten – und damit für die Materialqualität des Zements. Zusätzlich wurde für jede eingesetzte Komponente ein zugehöriger CO₂-Faktor, ein spezifischer Emissionswert, herangezogen, um den Gesamt-CO₂-Ausstoss zu ermitteln. «Das war eine sehr komplexe und rechenintensive Modellierungsarbeit», so der Wissenschaftler.
Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Mit den so erzeugten Daten konnte das KI-Modell lernen. «Statt Sekunden bis Minuten schaffen wir mit dem trainierten Netzwerk die Berechnung der mechanischen Eigenschaften für ein beliebiges Zementrezept in Millisekunden – also rund tausendmal schneller als beim klassischen Modellieren», erklärt Boiger.
Interdisziplinärer Ansatz mit grossem Potenzial
Unter den von den Forschenden identifizierten Zementrezepturen finden sich bereits vielversprechende Kandidaten. «Einige dieser Rezepturen haben echtes Potenzial», sagt John Provis. «Nicht nur in Bezug auf CO₂-Einsparung und Qualität, sondern auch, was die praktische Umsetzbarkeit in der Produktion betrifft.» Um den Entwicklungszyklus abzuschliessen, müssen die Rezepte jedoch erst noch im Labor getestet werden. «Wir bauen jetzt nicht gleich einen Turm damit, ohne sie vorher zu prüfen», schmunzelt Nikolaos Prasianakis.
Die Studie dient in erster Linie als Proof of Concept – also als Machbarkeitsnachweis dafür, dass sich vielversprechende Rezepturen auch rein rechnerisch identifizieren lassen. «Wir können unser KI-Modellierungstool beliebig erweitern und zusätzliche Aspekte integrieren, beispielsweise was die Produktion oder Verfügbarkeit der Rohstoffe betrifft oder wo der Baustoff eingesetzt wird – in mariner Umgebung, wo Zement und Beton sich anders verhalten, oder gar in der Wüste», so Romana Boiger. Nikolaos Prasianakis blickt bereits weiter: «Das ist erst der Anfang. Der Zeitgewinn, den ein so allgemeiner Workflow bietet, ist enorm – und macht ihn sehr vielversprechend für alle Arten von Material- und Systemdesigns.»